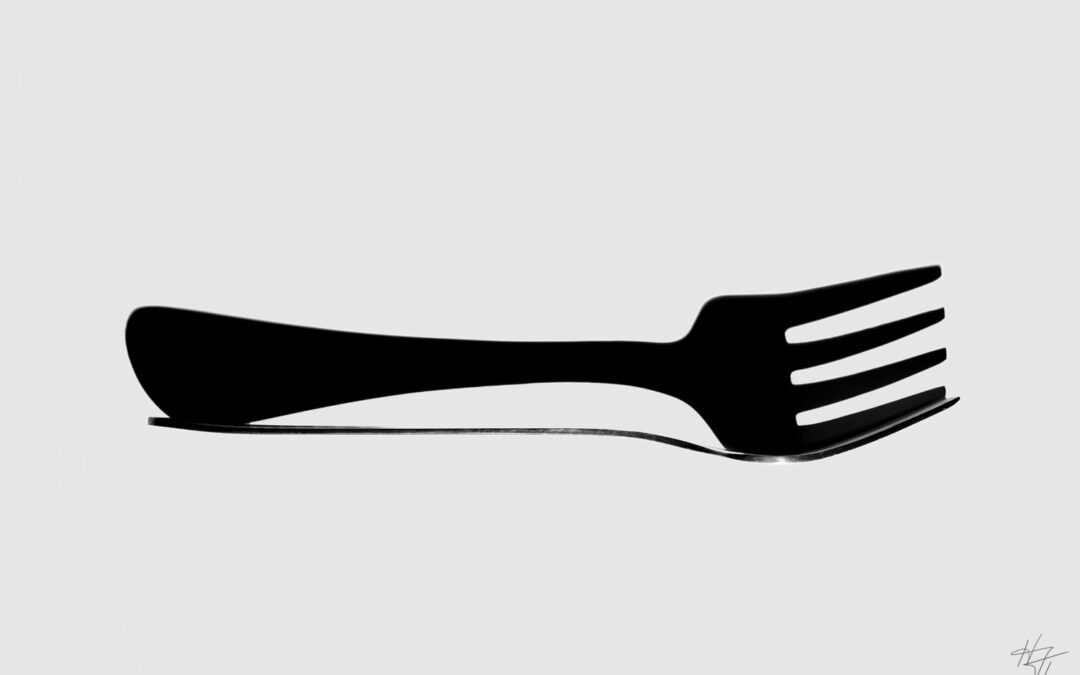Schönheit
Schönheit
Wer sich heute über Schönheit Gedanken macht, sieht sich wahrscheinlich früher oder später dem Vorwurf der Profanität, wenn nicht gar geistloser Oberflächlichkeit ausgesetzt. In einer fast vollständig auf materielle Äußerlichkeiten fixierten Welt scheint Schönheit nach Geld und Macht das einzige noch im Wertekanon verbliebene und anerkannt erstrebenswerte Ziel. In so einer Welt muß mit Schönheit eine äußerliche Schönheit gemeint sein.
Fitness-Studios, Beauty-, Kosmetik-, Lashes-, Nagel-, Waxing-, Tattoo-, Piercingstudios, Modegeschäfte, Friseure, Drogerien sprechen in ihrer schieren Masse eine deutliche Sprache. Sie sprießen, wachsen und gedeihen an jeder Straßenecke. Meist dort, wo zuvor eine Buchhandlung, ein Antiquariat, ein Plattengeschäft oder eine Galerie geschlossen hat.
Ein Blick in die Geistesgeschichte mag hier heilsame, für manche auch überraschende Wirkung tun. Zu allen Zeiten und Epochen scheinen sich Menschen schon Gedanken über Schönheit gemacht zu haben. Und zwar nicht jene, die nach Sanktionierung ihrer Bemühungen um den Anschluß an den Massengeschmack lechzten, sondern gerade die besten, die größten Geister, die die Menschheit hervorgebracht hat, unter ihnen Philosophen, Schriftsteller, Künstler, Mystiker, Theologen, Wissenschaftler.
Als ich einst an der Universität Bochum das Studium der Psychologie aufnahm, war eines der ersten Projekte, mit dem wir uns befaßten, eine Studie über die Attraktivität von Gesichtern.
Sich dem im 19. Jahrhundert immer dominanteren Materialismus unterordnend, hatte die Psychologie ab Mitte jenes Jahrhunderts ihre Bemühungen verstärkt, als empirische Wissenschaft anerkannt zu werden. Und auch wenn sie dieses Ziel zu Beginn des 20. Jahrhunderts formal erreicht hatte, reichen ihre Minderwertigkeitskomplexe gegenüber den arrivierten Naturwissenschaften bis in die Gegenwart. Mag ihr Hintertreffen durch den gar nicht direkt beobachtbaren und schon gar nicht meßbaren Gegenstand ihrer Studien noch so erklärbar, ja entschuldbar erscheinen. Die daraus folgenden, teils grotesken Überkompensationen sind auch in der modernen Psychologie eher die Regel als die Ausnahme.
Ich sah mich also einer endlosen Reihe stark schematisierter Gesichter gegenüber, man könnte sie auch schlicht Strichmännchen nennen. Mit jeweils leicht variierten Anordnungen der Hauptelemente Augen, Augenbrauen, Nase und Mund, die von Versuchspersonen bezüglich ihrer Attraktivität beurteilt werden sollten. Durch Ausmessen der mathematischen Bezüge zwischen den einzelnen Elementen wollte die Studie eine verläßliche Aussage darüber machen, was allgemein als attraktiv und schön empfunden wird. Völlig unerwartet schien z.B. eine gewisse Symmetrie als schön empfunden zu werden, soviel Ironie sei mir erlaubt. Als an der Seele interessierter hoffnungsvoller Aspirant der Wissenschaft ebendieser, hätte ich enttäuschter nicht sein können.
Wäre mir mein Philosophielehrer in der Oberstufe nicht etwas unangenehm gewesen, hätte ich vielleicht damals in Bochum schon den Zusammenhang mit einer uralten Definition von Schönheit der griechischen Antike erkannt. Diese besagt, daß die Schönheit eines beliebigen materiellen oder ideellen Gegenstands begründet liegt im harmonischen Verhältnis sowohl der Teile untereinander als auch der Teile zum Ganzen. Man könnte nun mit böser Zunge feststellen, daß wir auf dem Weg von Athen nach Bochum nicht allzu weit gekommen sind. In Wahrheit sind wir mächtig herumgekommen.
Der sagenumwobene Pythagoras, der ungefähr 570 bis 510 vor Christus lebte, soll in musikalischen Harmonien mathematisch darstellbare Verhältnisse entdeckt haben.
Aufeinanderfolgende Töne werden als harmonisch klingend empfunden, wenn das Verhältnis ihrer Frequenzen mit einfachen ganzen Zahlen ausgedrückt werden kann. Hinter der Realität gab es also scheinbar eine mathematische Ordnung. Mathematik und Musik fügten sich widerstandslos in die pythagoreische Kosmologie. Und beides war schön.
Der Gedanke, daß Menschen auch andere tonale Verhältnisse als harmonisch oder besser, als schön empfinden könnten, kam anscheinend niemandem. Aller vermeintlich objektiven Wissenschaft zum Trotz geht der Menschen eben doch immer von sich selber aus. Ich werde später auf Pythagoras zurückkommen.
Platon, dieser philosophische Titan, der irgendwie aus einer anderen Welt gekommen sein muß, baute etwas später vielleicht auf Pythagoras’ Entdeckungen auf. Irgendetwas sagte ihm, daß hinter allem, was wir in unserer Welt wahrnehmen können – und oft genug als nicht perfekt wahrnehmen –, eine perfekte Idee steht, von der das Sichtbare ein mehr oder weniger gelungenes Abbild ist. Diese von uns nicht direkt wahrnehmbare Idee ist schön in ihrer Perfektion; und je mehr von ihr in ihrem materiellen Konterfei sinnlich erfahrbar wird, als desto schöner empfinden wir es. Er hatte dabei wohl auch die Mathematik, namentlich die Geometrie im Hinterkopf, denn eines seiner Beispiele war der Kreis. Der bekanntlich nur solange ideal und perfekt ist, wie er mathematisch beschrieben ist. Sobald wir versuchen, einen Kreis zu bilden, zu formen, zu zeichnen, weicht das Ergebnis bekanntermaßen mehr oder weniger deutlich von der Idealform ab.
Platons Idee fanden viele sehr ansprechend, so daß sie immer wieder von späteren Denkern aufgenommen wurde, ob es nun Philosophen oder Naturwissenschaftler waren.
Platon hatte aber noch mehr zum Thema Schönheit zu sagen. Er hatte dabei wohl mehr den Menschen im engeren Sinn und wurde dann sehr streng. Als schön mochte er nur das befinden, was tugendhaft war. Und so detailliert er diesen Gedanken auch ausarbeitete und darzulegen versuchte, hat er meines Erachtens doch einen großen Pferdefuß. (Kritisiere ich hier etwa gerade den großen Platon? :-$). Denn hier muß jemand definieren, was unter tugendhaft verstanden wird. Platon zögert auch nicht, das zu tun. Die Erfahrung zeigt aber, daß sich von Zeit zu Zeit ändert, was Menschen als tugendhaft empfinden. Und daß es immer Menschen sind, die hierzu die Regeln festlegen. Und daß sie sich niemals darüber einig sind.
Natürlich ist der Grundgedanke brilliant. Man könnte ihn vielleicht dahingehend abwandeln, daß von einem Menschen oft das als schön empfunden wird, was ER SELBER zu diesem Zeitpunkt für tugendhaft hält. Und ja, manchmal finden Menschen es eben tugendhaft, überhaupt nicht tugendhaft zu sein.
Und hier muß ich interessanterweise zu meiner Oma springen. Die formulierte den Sachverhalt nämlich ganz ähnlich: „Schön ist nicht schön, Gefallen macht schön.“ Ich bin sicher, daß jedermanns und -fraus Oma so etwas ähnliches schon einmal geäußert hat: „Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters.“ Das gilt wohl für menschliches Aussehen, Verhalten wie überhaupt für alle Dinge.
Unsere lebensklugen Omas bringen also den Gedanken ein, daß Schönheit subjektiv sein könnte. Nun steht Platon also dumm da, denn seinen perfekten Ideen bzw. Idealen sagt er ja eine inhärente, objektive Schönheit nach. Zu dumm, daß sie sich durch beharrliche Unsichtbarkeit der Überprüfung sämtlicher Thesen entziehen.
Dann, viel später, trat Plotin auf, 205 bis 270 n. Chr. lebend und Begründer der neuplatonischen Schule. Wie man sich einfach erschließen kann, war er von Platons Ideen immer noch sehr beeindruckt und sponn sie weiter. Zum Thema Schönheit hat er einen wesentlichen Beitrag geleistet, den niemand so schön ausgedrückt hat, wie Werner Heisenberg in einem Vortrag vor der Akademie der Schönen Künste in Berlin. Schönheit sah Plotin danach „als das Durchleuchten des ewigen Glanzes des ‚Einen‘ durch die materielle Erscheinung.“
Kommen wir zunächst zurück zu Pythagoras. Wie sich später herausstellte, ist es mitnichten so, daß die idealen mathematischen Zahlenverhältnisse hinter Tönen dem menschlichen Ohr ausnahmslos perfekt harmonisch erscheinen. Die Angelegenheit erwies sich als deutlich komplizierter, wie die vielen Ansätze und Traktate über das Stimmen von Musikinstrumenten in den folgenden Jahrhunderten beweisen. Erst in der Barockzeit fand Bach mit der wohltemperierten Stimmung einen als für unsere Ohren harmonisch akzeptierten Kompromiß. Allerdings kann diese Behauptung sicher nicht für alle Kulturkreise des Erdballs gleich gültig erklärt werden.
Es zeigte sich also, daß die angenommenen idealen Ideen hinter den wahrnehmbaren Erscheinungen gar nicht unbedingt immer als schön empfunden werden, sondern daß die tatsächlich empfundene Schönheit oft ein wenig daneben liegt, und mathematisch in von Mathematikern als unschön empfundenen krummen langen Kommazahlen ausgedrückt werden müßte.
Was Plotin also mit dem durchscheinenden Glanz des Einen meinte, könnte sich also von den idealen Formvorbildern Platons und Pythagoras’ unterscheiden. Aber um was könnte es sich hier handeln?
Die gleichförmigen Strichgesichter der psychologischen Studie, so symmetrisch sie unter Umständen auch waren, empfand ich in keinster Weise als attraktiv. Und jeder, der mit einem Bildbearbeitungsprogramm oder auch nur mit einer Schere umgehen kann, kann leicht selbst überprüfen, welch subtiler Horror von einem perfekt symmetrischen Gesicht ausgeht. Es sind die kleinen Abweichungen, die etwas auseinanderstehenden oder höhenversetzten Augen, die leicht abstehenden Ohren, die etwas zu großen Nasenflügel, das asymmetrische Grübchen, die charaktervoll, schön und attraktiv erscheinen. Sie faszinieren, erzählen Geschichten, machen einmalig und unverwechselbar.
An diesem Punkt muß unsere Oma wieder ins Spiel kommen. Denn sie stellte auf breiter empirischer Basis fest, daß ein Mensch, so perfekt symmetrisch oder auch wunderbar von der Symmetrie abweichend er auch gewachsen sein mag, niemals immer allen gefällt.
Unsere Omas stoßen hier den Mathematikern, Wissenschaftlern und allen Menschen vor den Kopf, die so sehr vernarrt in den Gedanken der Objektivität sind. Ihr Denken kreist beständig um einheitliche und allgemeinverbindliche Normen, Regeln, Gesetze. Der Gedanke, daß die Welt rein subjektiv sein könnte, macht sie ganz krank. Diese Art Menschen empfindet alles als beruhigend schön, was rational und logisch nachvollziehbar, möglichst auch berechenbar und somit vorhersagbar ist. Im Laufe der letzten beiden Jahrtausende haben sie nahezu absolute Meinungshoheit im öffentlichen, wissenschaftlichen und philosophischen Diskurs erlangt. Nur unsere Omas haben sie niemals überzeugen können.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich bin fest überzeugt, unsere Omas hätten Plotin mit Freude zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Und Plotin hätte Blumen mitgebracht. Sie hätten sich angeregt unterhalten und prima verstanden.
Denn jeder Mensch hat etwas einzigartiges (und damit auch etwas unberechenbares und unvorhersagbares), das er natürlich nur haben kann, gerade weil er im Detail von einer wie auch immer gedachten Idealform abweicht. Und das gleichzeitig in keiner Weise von allem anderen getrennt ist, das also mit Recht als „das Eine“ bezeichnet werden könnte. Das, mit dem wir alle verbunden sind, ohne uns dessen wirklich bewußt zu sein, denn über die Jahrhunderte haben wir alle irgendwann angefangen, den bestechend logischen Rationalisten zu glauben. Etwas, zu dem wir uns unbewußt zurücksehnen, von dem wir uns angezogen fühlen, das also sehr attraktiv ist. Das Wort attraktiv geht schließlich auf das lateinische atrahere (anziehen) zurück. Da ist etwas, das leuchtet und scheint, und vor allem im Glanz der Augen wahrgenommen werden kann. Es ist in faszinierender und verstandübersteigender Weise gleichzeitig einmalig und eins mit allem anderen. Es erklärt, warum ein und derselbe Mensch von dem einen als gewöhnlich und von dem nächsten als wunderschön empfunden wird.
Es ist das, was die Psychologie in ihrer Anbiederung an die Logik verworfen hat, was sie aber nach wie vor im Namen trägt: die Seele!
Aber halt! Sind Pythagoras, Platon, all die klugen Wissenschaftler, Mathematiker, Psychologen denn nun tatsächlich so ganz ohne blassen Schimmer? Ist es denn nicht tatsächlich oft eine gewisse Ebenmäßigkeit oder Ordnung, die wir als schön empfinden?
Nun, jede Seele ist einzigartig, in ihrer erscheinungsmäßigen Ausprägung, in ihrem Entwicklungsstand, ihrer Bewußtheit, ihrem Anliegen und ihren Absichten. Wäre es nicht zu erwarten, daß diese Eigenheiten sich auch in der physischen Form ausdrücken, die die Seele annimmt? Anders gesagt, wäre es nicht möglich, daß das, was wir als eine strahlend schöne Seele wahrnehmen, diese Schönheit nicht nur jenseits der sinnlichen Wahrnehmungsebene ausstrahlt, sondern auch in die sinnlich wahrnehmbaren Formen einprägt? Nicht nach meßbaren Gesetzmäßigkeiten, aber doch mit einer erfaßbaren Tendenz.
Fallen hier möglicherweise die Hauptströmungen der menschlichen Schönheitsüberlegungen zusammen? Nicht immer, nicht unveränderlich, aber doch ausreichend häufig, um unseren Omas aufzufallen.
Text und Photographie: Jo Titze